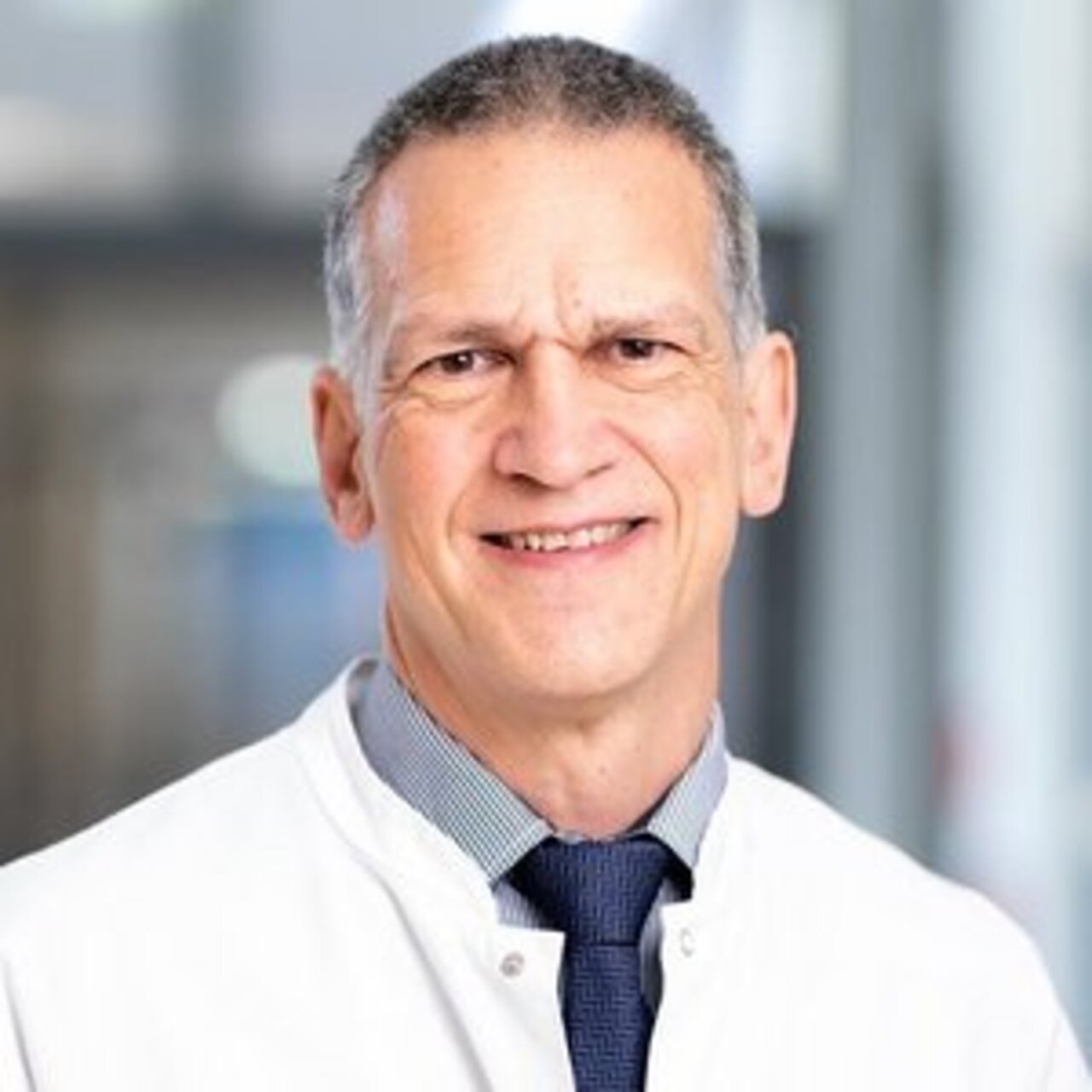Spezialisten für Kraniostenose
4 Spezialisten gefunden
Informationen zum Bereich Kraniostenose
Was ist eine Kraniostenose?
Bei einer Kraniostenose handelt es sich um eine Fehlbildung des knöchernen Schädels, der durch einen frühzeitigen Verschluss der sogenannten Schädelnähte entsteht.
Schädelnähte sind bindegewebige Verbindungen zwischen den verschiedenen knöchernen Anteilen des Schädels. Hierdurch kann sich das Gehirn entwickeln und der knöcherne Schädel passt sich dessen Wachstum an. Ist das Gehirn vollentwickelt und hat seine endgültige Größe erreicht, beginnt auch die Verknöcherung des Schädels. Im Normalfall geschieht dies etwa ab dem 6.-8. Lebensjahr.
Im Falle einer Kraniostenose setzt dieser Prozess frühzeitig ein, wodurch der Schädel eine abnorme Form annimmt. Zudem sind auch Komplikationen wie ein erhöhter Hirndruck möglich, weil das sich entwickelnde Gehirn zu wenig Platz hat.
Insgesamt handelt es sich bei der Kraniostenose um ein seltenes Krankheitsbild, schätzungsweise tritt die Fehlbildung bei etwa einem von 2000 Säuglingen auf. Dabei können sowohl einzelne als auch mehrere Schädelnähte betroffen sein. Das Krankheitsbild kann milde oder auch schwerwiegend mit weitreichenden Komplikationen verlaufen.
Wie entsteht eine Kraniostenose?
In vielen Fällen ist die genaue Ursache des frühzeitigen Verschlusses einer Schädelnaht unklar. Man unterscheidet primäre Formen von sekundären Kraniostenosen. Bei primären Kraniostenosen liegt eine direkte Verknöcherungsstörung der Schädelnähte vor. Sie kann entweder ohne erkennbare Ursache oder im Rahmen einer genetischen Störung vorliegen. Bestimmte Syndrome gehen dabei mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten einer Kraniostenose einher. Zu diesen gehören beispielsweise das seltene Apert-Syndrom oder das Crouzon-Syndrom.
Sekundäre Formen treten als Folge einer anderen Erkrankung auf. So kann beispielsweise Platzmangel im Mutterleib zur frühzeitigen Verknöcherung der Schädelnähte führen. Ebenso können bestimmte Erkrankungen wie beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion, Sichelzellenanämie oder Thalassämie Ursache einer Kraniostenose sein. Auch die Einnahme bestimmter Medikamente während der Schwangerschaft kann das Krankheitsbild auslösen.
Am häufigsten tritt eine Kraniostenose isoliert ohne weitere Krankheitszeichen und nur im Bereich einer einzelnen Schädelnaht auf.
Typische Anzeichen und Symptome
Eine Kraniostenose kann sich auf sehr unterschiedliche Weise präsentieren, je nachdem wie viele bzw. welche Schädelnähte von der frühzeitigen Verknöcherung betroffen sind. Hat der Verschluss nur bei einer der insgesamt sechs Schädelnähte zu früh eingesetzt, dann bleiben schwerwiegende Komplikationen in der Regel aus und es handelt sich vornehmlich um ein kosmetisches Problem. Während bei milden Formen lediglich eine tastbare Knochenwulst vorliegt, können schwerere Formen zu deutlichen Fehlbildungen des Schädels führen, die für die Betroffenen eine starke Belastung bedeuten können.
Sind mehrere Schädelnähte von einer frühzeitigen Verknöcherung betroffen, kann es zum Platzmangel innerhalb des Schädels kommen. Hierdurch entsteht innerhalb des sich entwickelnden Gehirns ein erhöhter Druck, der mit weitreichenden Komplikationen wie Übelkeit, Erbrechen, Seh- und Hörstörungen oder Entwicklungsverzögerung einhergehen kann.
Wie wird eine Kraniostenose diagnostiziert?
Je nach Ausmaß der Erkrankung und Vorhandensein begleitender Krankheitszeichen kann eine Kraniostenose bereits vor Geburt oder erst im Alter von einigen Monaten diagnostiziert werden. Liegen Risikofaktoren wie beispielsweise bekannte Erkrankungen bzw. Syndrome in der Familie vor, dann kann bereits während der Schwangerschaft gezielt nach Fehlbildungen des Schädels gesucht werden. Zum Einsatz kommen dabei meist Ultraschall- oder auch humangenetische Untersuchungen. Wird dabei eine Kraniostenose entdeckt, dann wird in der Regel empfohlen, die Geburt in einem spezialisierten Zentrum durchzuführen.
Fällt eine Kraniostenose erst nach der Geburt auf, dann handelt es sich meist um eine Blickdiagnose im Rahmen der körperlichen Untersuchung. Diese wird dann durch bildgebende Verfahren bestätigt. Je nach Alter der Patienten können dabei verschiedene Verfahren angewendet werden, zu denen unter anderem der Ultraschall, CT- oder Röntgenuntersuchungen gehören. Humangenetische Untersuchungen können ebenso wichtige Hinweise auf die Ursache sowie teilweise auch zum möglichen Verlauf der Erkrankung liefern.
Welche Therapieoptionen gibt es bei Kraniostenose?
In den allermeisten Fällen wird eine operative Korrektur der Kraniostenose empfohlen. Wichtige Ziele der chirurgischen Therapie sind dabei die Verbesserung des kosmetischen Ergebnisses sowie die Verhinderung von möglichen Komplikationen wie einem erhöhten Hirndruck. Um ein möglichst gutes Behandlungsergebnis zu erzielen, sollte eine Operation in einem spezialisierten Zentrum durchgeführt werden.
Bezüglich des Zeitpunktes der Operation wird empfohlen, diese möglichst frühzeitig einzuleiten, da zu einem späteren Zeitpunkt meist aufwändigere Verfahren notwendig sind und die Erfolgsaussichten tendenziell schlechter sind. Im Durchschnitt wird eine Operation zwischen dem 3.und 14. Lebensmonat durchgeführt.
Im Rahmen der Operation wird versucht, eine möglichst natürliche Schädelform zu erzielen. Dazu wird meist ein kleiner Teil des Schädelknochens entfernt, bevor die Schädelform ggf. auch unter Anwendung von Implantaten rekonstruiert wird. Eingebrachtes Material zur Fixierung wie beispielsweise kleine Platten oder Schrauben müssen in der Regel nicht wieder entfernt werden und können lebenslang im Körper verbleiben, sodass kein weiterer Eingriff notwendig ist.
Wie ist die Prognose bei Kraniostenose?
Die Prognose einer Kraniostenose hängt vom Ausmaß der Erkrankung ab. Mildere Formen können in der Regel sehr gut operativ behandelt werden, sodass keine Komplikationen auftreten und die Betroffenen im späteren Leben kaum durch eine abnorme Schädelform auffallen.
Sind Komplikationen im Rahmen des Krankheitsbildes aufgetreten, hängen die Heilungschancen vor allem davon ab, wie schwerwiegend diese Komplikationen waren und wie schnell diese behandelt werden konnten. In vielen Fällen können aber auch in diesen Fällen gute Langzeitergebnisse erzielt werden, sodass die betroffenen Kinder sich weitgehend normal entwickeln können.
Welche Ärzte & Kliniken sind Spezialisten für die Behandlung einer Kraniostenose?
Um eine Kraniostenose sicher zu diagnostizieren und fachgerecht behandeln zu können, arbeiten dabei Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammen. Daher sind Fachärzte für Kinderheilkunde, Kinderchirurgie, Neurochirurgie, Radiologie sowie Humangenetik die kompetentesten Ansprechpartner. In einem spezialisierten Zentrum werden diese verschiedenen Kompetenzen gebündelt, um den Patienten und deren Familien ein multimodales Behandlungskonzept bieten zu können.
Wir haben sämtliche hier gelisteten Ärzte und Kliniken sorgfältig überprüft und hinsichtlich ihrer Expertise auf dem Gebiet der Kraniostenosen ausgewählt. Sie alle sind Experten ihres jeweiligen Fachgebietes und verfügen über weitreichende Erfahrung in der Diagnostik und Therapie. Überzeugen Sie sich gerne persönlich von der Fachkompetenz unserer Spezialisten und vereinbaren Sie direkt ein erstes individuelles Beratungsgespräch.
Quellen:
- Amboss, Nachschlagewerk für Mediziner. next.amboss.com/de/article/g40FiT [zuletzt aufgerufen am: 07.06.2025]
- S2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie von Patienten mit Kraniosynostosen. AWMF-Register-Nr. 007-108. Stand 21.09.2023. Version 1.0. Link: register.awmf.org/assets/guidelines/007-108l_Diagnostik-Therapie-Patienten-mit-Kraniosynostosen_2023-10.pdf [zuletzt aufgerufen am 07.06.2025]
- „Moderne Behandlung von Kraniosynostosen“, verfasst von: Dr. med. Leon Schmidt, Verena Fassl, Laura Erhardt, Julia Winter, André Lollert, Julia Heider, Malte Ottenhausen. Erschienen in: Monatsschrift Kinderheilkunde. 21.01.2023. Link: www.springermedizin.de/kinderchirurgie/kinderchirurgie/moderne-behandlung-von-kraniosynostosen/23939602 [zuletzt abgerufen am 07.06.2025]